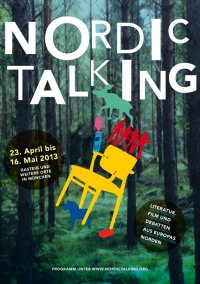
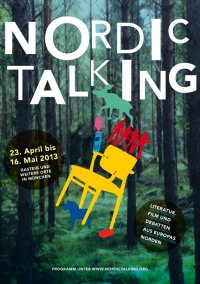
98 PROLOG Die Sehnsucht, die aus den Augen Fritjovs spricht, ist die gleiche, die auch die Menschen nach Vimmerby zieht oder sie am Sonntagabend vor ei- nen Bildschirm treibt, auf dem ein Inga-Lindström- Film flimmert. Es ist die Sehnsucht der Deutschen nach einem Ort, an dem es ganz ähnlich ist wie zu Hause – nur noch schöner, eben ohne all die Pro- bleme, die uns im Alltag ärgern. Eine Sehnsucht, die übrigens nicht nur von Drehbuchautoren und Rei- severkehrskaufleuten erfolgreich ausgenutzt wird, sondern immer wieder auch von der Politik. Egal ob liberal, links oder konservativ – im so genannten Nordischen Modell findet jeder Reformansätze, die sich als Vorbild für die jeweils eigenen Ziele eignen. Und solche Vergleiche lassen sich in Talk- shows eben wunderbar zu bekräftigenden Satzan- fängen formen, wie: „In Schweden gibt es schon längst ...“, „Die nordischen Länder machen uns seit langem vor, wie ...“ oder „Die Dänen haben bereits vor Jahren erkannt, dass ...“. Tief in unserem Inneren wissen wir natürlich, dass es unseren Sehnsuchtsort eigentlich gar nicht gibt. Bullerbü ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Ein Gefühl, das übrigens maßgeblich zum Erfolg nordischer Kriminalliteratur beigetragen ha- ben dürfte. Dort geht es ja meist um jene dunklen Geheimnisse, die unter der bunten Fassade des Wohlfahrtsstaates schlummern. Die kleine, kleine Stadt, in der Pippi Langstrumpf ihre Abenteuer erlebt, gibt es wirklich. Sie heißt Vimmerby, liegt in Småland, und im Sommer kann man dort vor lauter deutschen Touristen kaum noch das Kopfsteinpflaster der pittoresken Stra- ßen erkennen. Wer die berühmten Bücher kennt, der findet in Vimmerby die Orte, aus denen Astrid Lindgren ihre Inspiration bezog: Das alte Pfarr- haus, das in ihrer Fantasie zur Villa Kunterbunt wurde. Die knorrige Ulme, aus der sie den Limona- denbaum machte. Und wer mit dem Auto ein biss- chen aus der Stadt hinausfährt, findet sogar drei Höfe, die das Vorbild für Bullerbü waren. Nicht wenige Deutsche kehren nach so einer Reise mit der Überzeugung heim, gerade ein Land besucht zu haben, in dem die Idylle ihrer Kindheitsträume Wirklichkeit ist. Sie stehen damit, meist ohne es zu wissen, in einer langen Tradition. Der Norden Europas ist seit Generationen der Sehnsuchtsort vieler Deutscher. Schon Kaiser Wilhelm II. verbrachte, lange bevor Astrid Lind- gren geboren wurde, seine Sommerurlaube stets mit der Jacht „Hohenzollern“ im norwegischen Sognefjord. Der Monarch schwärmte wie viele seiner Zeitgenossen für Wikinger. Am Fjord kann man die Folgen heute noch in Form einer 22 Meter hohen, etwas klobigen Bronzefigur bestaunen, die den Wikingerkönig Fritjov darstellt. Der muskulö- se Held blickt verträumt übers Wasser, die Rechte hat er lässig auf ein riesiges Schwert gestützt, so als wäre es ein Spazierstock. Wilhelm II. hat den Norwegern das Standbild einst geschenkt. Es zeugt nicht nur von seiner Liebe zur nordischen Sagen- welt, sondern auch von der naiven Verehrung für den Standort der Figur. Die Wahrheit freilich findet sich weder in den Krimis noch bei Inga Lindström. Die kann nur er- kennen, wer sich wirklich auf die Länder und ihre Menschen einlässt, wer ihre Debatten verfolgt, ihre Probleme und Alltagssorgen ernst nimmt und in ihre Kultur eintaucht. Wer das tut, wird schnell feststellen, dass ihm Nordeuropa in vielem be- kannt vorkommt. Die Menschen dort sehen sich oft mit denselben Widrigkeiten konfrontiert wie die Menschen hierzulande. Manchmal haben sie bessere Lösungen gefunden, die das Leben an- genehmer machen – und manchmal nicht. Das Entscheidende ist: Weil wir uns so ähnlich sind, können wir gut voneinander lernen. Vorausge- setzt, wir sehen genau hin. In Vimmerby zum Beispiel gibt es ein Museum, in dem Astrid Lindgrens Leben nachgezeichnet wird. Da erfährt man, dass die große Autorin als 18-Jährige ein uneheliches Kind vom Chef der Vimmerbyer Lokalzeitung bekam. Sie musste des- halb die kleine, kleine Stadt verlassen – Småland war damals eben kein reines Paradies für alle Kin- der, jedenfalls nicht für uneheliche. Lindgren, die damals noch Ericsson hieß, zog nach Stockholm und musste ihren Sohn Lars zu einer Pflegefamilie im 800 Kilometer entfernten Kopenhagen geben, denn in Schweden gab es damals keine entspre- chende Unterstützung für Alleinerziehende. Oft fuhr die junge Frau am Wochenende quer durch Skandinavien, um wenigstens ein paar Stunden mit ihrem Kind zu verbringen. Im Museum in Vimmer- by liegt ihr Reisepass aus jener Zeit, der über und über mit dänischen Stempeln bedeckt ist. So sah die Realität aus, in der die Geschichte von Buller- bü erfunden wurde. Die Sehnsucht nach Bullerbü Von Gunnar Herrmann Gunnar Herrmann, geboren 1975, studierte Geschichte und zog 2006 mit seiner Familie als Nord-Europa-Kor- respondent der Süddeutschen Zeitung nach Stockholm. Mit seiner Frau Susanne Schulz publizierte er mehrere Bücher über diese Umsiedelung („Elchtest“, 2010) und die Eingewöhnungsphase in Schweden („Alter Schwede“; 2012). Bei „Nordic Talking“ moderiert Gunnar Herrmann die Diskussion über Rechtspopulismus in Skandinavien. Gunnar Herrmann, geboren 1975, studierte Geschichte und zog 2006 mit seiner Familie als Nord-Europa-Kor- respondent der Süddeutschen Zeitung nach Stockholm. Mit seiner Frau Susanne Schulz publizierte er mehrere Bücher über diese Umsiedelung („Elchtest“, 2010) und die Eingewöhnungsphase in Schweden („Alter Schwede“, 2012). Bei „Nordic Talking“ moderiert Gunnar Herrmann die Diskussion über Rechtspopulismus in Skandinavien. Di 23.04. 19:00 Uhr / Gasteig, Black Box ERÖFFNUNGSPERFORMANCE mit Hallgrímur Helgason und dem dj-duo NØrdic by Nature • Bild © Ola ericson/image- bank.sweden.se