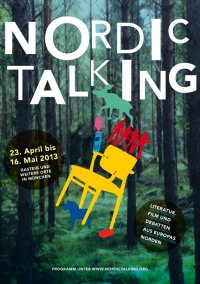
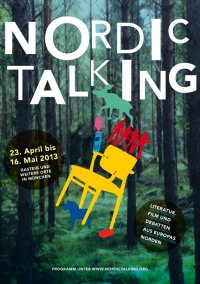
54 PROLOG Was die skandinavischen Gesellschaften vonei- nander trennt, was sie eint, dazu gibt es ebenso viele historisch fundierte Meinungen wie romanti- sierende Klischees. Die Werke unser Festivalgäste aus Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden bringen auf vielfältige Art zum Aus- druck, dass die Länder weit mehr verbindet als das weite Meer und der blaue Himmel. Die Frage nach dem Kern dessen, was die Län- der im Norden überhaupt ausmacht, beantworten vielleicht am besten diejenigen, die nicht schon immer dazugehört haben. Vatanescu, der Held aus Tuomas Kyrös finnischem Schelmenroman „Bettler und Hase“ ist ein Neuankömmling. Auf der Suche nach ein bisschen Glück und Geld setzt sich der rumänische Rom listig mit den „verhätschelten Sozialdemokraten“ in Finnland auseinander und wird selbst mit harten Lebensbedingungen kon- frontiert. Das Verhältnis von Minderheit und Mehrheit prägt auch durchgängig das literarische Schaffen des finnlandschwedischen Schriftstellers Kjell Westö. Der ausgezeichnete Erzähler liefert in sei- nen Romanen plastische Zeitporträts von Finnland und ergänzt so das Bild, das einem schon aus Mika- el Niemis „Populärmusik aus Vittula“ über Finnen in Schweden vertraut ist. Als Sohn einer Österreicherin und eines Grie- chen in Schweden aufgewachsen, lässt Aris Fiore- tos ebenfalls eigene Erfahrungen in die Gestaltung seiner Romanfiguren einfließen, die nicht zuletzt durch ihre flexiblen Identitäten auffallen. In sei- nem neuen Emigrantenepos „Die halbe Sonne" verknüpft er die persönliche Suche nach den Spu- ren des Vaters mit der akribischen Vermessung zweier europäischer Extreme: der schwedischen und der griechischen Gesellschaft. Er stößt dabei immer wieder auf angelehnte Türen, auf Durchläs- se und Übergänge zwischen den scheinbar festen Mauern. Der nächsten Migrantengeneration gehört Alen Meškovic´ an. Er ist 1977 in Bosnien geboren und behauptet keck, „kulturelle Unterschiede werden überbewertet“. Dänisch, so der junge Autor, habe er gelernt, weil er sein Leben zurückerobern woll- te: „Leute treffen, Partys feiern.“ Sein auf Dänisch verfasstes Romandebüt „Ukulele Jam“ beschreibt die Stationen des 14-jährigen Kriegsflüchtlings Miki, der mit Musik und Partys versucht, dem für ihn omnipräsenten Balkankrieg zu entfliehen. Größtes Verständnis würde ihm Hallgrímur Hel- gasons greise Heldin aus „Eine Frau bei 1000°“ entgegen bringen. Sie blickt angesichts ihres na- hen Todes mit knochentrockenem Humor auf ihr Leben zurück. Konventionen und Traditionen, das ist schnell klar, spielten für sie darin kaum eine Rol- le. Moral hingegen schon, und die legt sie vor allem in puncto Weltkrieg sehr eng aus. Die alte Herb- jörg ist mit dieser Haltung nicht die einzige. Auch in Lars Saabye Christensens großartigen Romanen fällt der entlarvende Blick der Protagonisten und der feine Sinn des Erzählers für skurrile Gestalten und Situationen auf. Vorwort Die Hauptfiguren in Kirsten Hammanns Roman „Se på mig“ (Sieh mich an), haben hingegen nichts Doppelbödiges. Sie sind zwei typische Vertreter der dänischen Mittelklasse mit ihren Tagträumen und Wirrungen. Julie stürzt sich in ein Abenteu- er mit Sune, der sich auf dem Weg zum großen schriftstellerischen Erfolg glaubt und auf ein staat- liches Stipendium hofft. Ein raffinierter Roman, der von Fürsorge, erotischer Anziehung und gleichzei- tig von Existenzängsten erzählt. Tatsächlich ermöglicht es die nordische Kul- turpolitik, dass die Adressatinnen und Adressa- ten staatlicher Stipendien von ihrer Kunst leben können. Wahrscheinlich ist das ein Grund dafür, warum Lyrik im Norden bei weitem nicht das Ni- schendasein fristet wie bei uns und warum sich viele Künstlerinnen und Künstler in spartenüber- greifenden Projekten engagieren können. Bester Beweis sind der dänische Lyriker Morten Søn- dergaard sowie der aus Oslo stammende Dichter und Übersetzer Arild Vange, die eine große Nähe zur Musik verbindet. Beide treten im Rahmen von „Nordic Talking“ auf: Morten Søndergaard als Wortkünstler mit seiner „Wortapotheke“, Arild Vange als Improvsationskünstler mit der norwe- gisch-schottischen Musikgruppe DVELL. Ohne die hervorragende Filmförderung hät- te sich auch der isländische Film nicht in derart kurzer Zeit so fantastisch entwickelt. Spätestens mit der Oscar-Nominierung von Friðrik Þór Frið- rikssons „Börn náttúrunnar“ (Kinder der Natur) hat Island 1991 den Sprung auf die internationale Landkarte des Films geschafft. Interessanterweise setzen Filmemacher seitdem häufig lokale Themen so überzeugend in Szene, dass sich das Publikum weltweit begeistern lässt. Dank der großzügigen Unterstützung durch das Icelandic Film Center ist es gelungen, eine umfassende Retrospektive der jungen isländischen Filmgeschichte mit ihren Anfängen in den 1970er-Jahren im Rahmen von „Nordic Talking“ zu präsentieren. Der Vater des „isländischen Filmwunders“ Friðrik Þór Friðriksson wird diese Filmschau am 25. April eröffnen. Das Thema Kulturförderung sowie die vorbild- liche skandinavische Kulturarchitektur und Frau- enpolitik spielen im Debattenprogramm eine ausführlichere Rolle. Hier finden jedoch noch an- dere zentrale Themen Widerhall. Selbst unsere gut aufgestellten Nachbarländer sind vor Krisen nicht gefeit. Der Bankencrash 2008 in Island, der konfliktgeladene Run auf die arktischen Rohstoffe oder das Attentat auf Utøya haben fundamentale Diskussionen über das Selbstbild der nordischen Gesellschaften in Gang gebracht, die bei „Nordic Talking“ von Journalisten wie Harald Stanghelle und Alexander Bengtsson, von Wirtschaftspoliti- kern wie Ali Esbati und hier im Katalog u.a. vom amtierenden Reykjavíker Bürgermeister Jón Gnarr kommentiert werden. Nach den „Stimmen der Roma“, dem ersten von Münchner Stadtbibliothek und Münchner Volks- hochschule (mit dem Tschechischen Zentrum) gemeinsam getragenen Festival im Frühjahr 2012, freuen wir uns nun, mit „Nordic Talking“ unseren Nachbarn aus Europas Norden hier im „Süden“ mit einer Vielzahl von Lesungen, Diskussionen, Filmvorführungen und Konzerten begegnen zu können. God fornøjelse Klaus Blanc, Münchner Volkshochschule Anke Buettner und Sabine Hahn, Münchner Stadtbibliothek