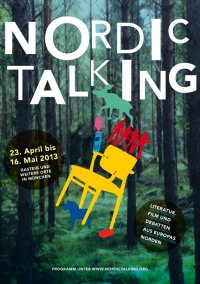
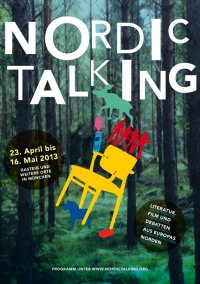
45 Was ist mit dem Wort „Kuára“, dem Titel des Al- bums, gemeint? Kuára ist udmurtisch und bedeutet Klang. Samuli Mikkonen, der „Kuára“-Pianist, und ich interessie- ren uns schon lange für Volksmusik. Unsere musi- kalischen Wurzeln sind meiner Meinung nach die Grundlage des europäischen Jazz. Seit den 1960er- Jahren haben wir diesen neuen Weg beschritten, um unseren eigenen Sound neben dem der ameri- kanischen Musiker zu finden. Die Musik der Kare- lier, der Wepsen und der Udmurten kommt mir sehr vertraut und nah vor. Wir Finnen sind eine Mischung aus Skandinavischem und Slawischem, also östli- cher Kultur. Ich mag das Slawische sehr: eine sehr melancholische, aber nicht depressive Musik. Deren einfache Melodien erlauben uns, ganz natürlich und inspiriert zu improvisieren. Vor allem aber fühlen wir diese Musik tief in uns. Sankt Petersburg stand ja über Jahrhunderte in enger Beziehung mit dem finnischen Volk, 100 Jahre herrschte Russland über uns. Meine eigene Familie ist ein gutes Beispiel: Mein Vater ist zur Hälfte russisch. Ich bin also auch mit orthodoxer Musik und Kultur aufgewachsen. Da er das einzige harmonische Instrument spielt, hat der Pianist Samuli Mikkonen vermutlich eine wichtige Rolle bei den Arrangements übernom- men? Wir haben alle Stücke gemeinsam mit Samuli aus- gesucht und auch die Arrangements gemeinsam gemacht. Natürlich bedient sich vor allem Samuli der Freiheit zur Improvisation, da die ganze Har- monie in seinen Händen liegt. Jedoch wollten wir alles so offen wie möglich halten, deshalb bilden die schönen Melodien erst einmal die Grundlage, und alles andere – wie wir sie spielen, wer sie spielt, was davor geschieht, was danach geschieht – bleibt of- fen. In jedem Konzert spielen wir eine ganz andere Version; etwa 90 Prozent unserer Musik besteht aus Improvisation, würde ich schätzen. Der norwegische Trompeter Per Jørgensen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle – wie entscheidend war die Anwesenheit dieses Altmeisters für die Aufnahme? Per ist wirklich ein einzigartiger Meister seiner Kunst. Wir waren so froh, ihn bei uns zu haben. Es ist unglaublich, wie er sich auf die Musik fokussiert und den Moment lebt. Wenn wir ein Konzert spie- len, versenkt er sich richtig tief in die Musik. Auf der CD gibt es wepsische, udmurtische und karelische Volkslieder. Wo liegen deren histori- sche und geografische Ursprünge? Karelien war für Finnen auf der Suche nach ihren eigenen Wurzeln schon immer eine wichtige Quelle. Dort haben schon viele finnische Künstler Inspirati- on gefunden, von dem Komponisten Jean Sibelius bis hin zu dem Maler Akseli Gallen-Kallela. Die Kare- lier und die Wepsen leben an der östlichen Grenze, teilweise auch auf russischem Territorium. Udmur- tien liegt noch weiter östlich, nahe dem Ural in Si- birien. Die Udmurten sind eine verwandte Nation, ihre Sprache ähnelt unserer sehr. Ihre wirklich ein- zigartig klingende Volksmusik bestand schon immer hauptsächlich aus Gesang, basierend auf Gedichten und Klageliedern. Zu welchen sozialen oder religiösen Ereignissen wurde diese Musik gespielt? Sie diente vor allem rituellen Zwecken, in dem Fall heidnischen. Die Menschen beteten singend und baten ihre Götter um eine bessere Zukunft. Auf unserer Platte finden sich ein Kriegslied, zwei Hochzeitslieder – beides Klagelieder, da die Mutter ihre Tochter verliert – sowie ein Wiegenlied. Das Material haben wir über mehrere Jahre hinweg recherchiert, es stammt von frühen authentischen Aufnahmen und aus verschiedenen Archiven und Musikbibliotheken. Welcher rhythmische Aspekt dieser Musik faszi- niert Sie als Schlagzeuger? Vermutlich gerade das Fehlen eines festen Rhyth- mus oder Takts – mir geht es ja stets darum, mein In- strument auf eine „horizontalere“ Weise zu spielen. Und wenn doch ein durchgehender Rhythmus exis- tiert, dann handelt es sich oft um einen ungeraden 5/8- oder 7/8-Takt, was nicht weniger spannend ist. Der Gründer und Produzent des Labels ECM, Manfred Eicher, ist bekannt dafür, dass er auf jedes Detail achtet. Hat er mit Ratschlägen bei- getragen? Das war das dritte Mal, das ich mit Manfred Eicher gearbeitet habe, und es war jedes Mal ein Privileg. Er hat ein absolut unglaubliches Gefühl für das Ganze. Manchmal weist er auf ein Detail hin, das er ändern würde, und manchmal lässt er einem einfach die Zeit, den eigenen Weg zu finden. Und für die An- ordnung der Stücke auf der CD hat er ein wirklich magisches Händchen. Stellt „Kuára“ eine Weiterentwicklung Ihrer Mu- sik dar, verglichen mit Ihren früheren Werken? Ich weiß nicht … Ich habe nie klare Pläne gemacht. Ich versuche nur, meine musikalische Idee so gut als möglich umzusetzen, und denke nie daran, ob ich mich rückwärts oder vorwärts bewege. Das Wich- tigste ist, dass man versucht, den eigenen Sound und die eigene Persönlichkeit zu entdecken und dem zu folgen. © jazzconvention.net – Nico Conversano 44 Laut & LEISE Das fehlen von RhytHmus Ein Gespräch mit dem Schlagzeuger Markku Ounaskari Markku Ounaskari, geboren 1967, ist einer der be- kanntesten Jazz-Schlagzeuger in Finnland, der sich allerdings immer auch in anderen Genres umgetan hat. Ounaskari spielte bereits mit internationalen Größen wie Lee Konitz, Kenny Wheeler, Tomasz Stanko und Marc Ducret, bevor er 2010 das erste Album – „Kuára“ – unter seinem eigenen Namen publizierte. Markku Ounaskari, geboren 1967, ist einer der be- kanntesten Jazz-Schlagzeuger in Finnland, der sich allerdings immer auch in anderen Genres umgetan hat. Ounaskari spielte bereits mit internationalen Größen wie Lee Konitz, Kenny Wheeler, Tomasz Stan´ko und Marc Ducret, bevor er 2010 das erste Album – „Kuára“ – unter seinem eigenen Namen publizierte. • Di 23.04. 21:00 Uhr / Jazzclub Unterfahrt Kuára Konzert mit Markku Ounaskari