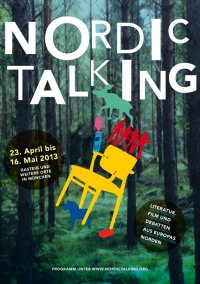
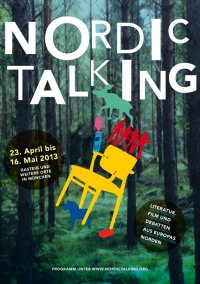
3130 BILDER & ZEITEN Ich bin in den 1960er-Jahren aufgewachsen, als der Vietnamkrieg großen Einfluss auf das Leben jedes Einzelnen nahm. Während des Zweiten Welt- kriegs war Island von britischen und amerikani- schen Truppen besetzt gewesen, danach ließ sich die NATO in Keflavík, 50 Kilometer entfernt von der Hauptstadt, nieder. Das einzige Fernsehen, das wir zu sehen bekamen, kam von dem Stützpunkt: vor al- lem Western, Science-Fiction und Kriegsfilme. Auch der Marshallplan sah eine Unterstützung Islands vor, und die bestand unter anderem darin, dass die Lo- kalregierung ein Kino für jedes große amerikanische Filmstudio errichtete. Auf dem Programm standen vor allem amerikanische Filme. Es ist allgemein bekannt, dass das Individuum durch die Einflüsse in den ersten zehn Jahren ge- formt wird. Ich habe während dieser Zeit die Spra- che der amerikanischen Filme mehr gefühlt denn verstanden. Ich erinnere mich, wie ich auf den Schwarz-Weiß-Bildschirm des Fernsehgeräts starrte und nicht die Dialoge verstand, sondern nur die Ge- schichte, die mittels der Bilder erzählt wurde. Ob das nun mit dieser Erfahrung zu tun hat oder nicht: Als Filmemacher habe ich Dialoge stets so weit als möglich zu vermeiden versucht. In den 1960er-Jahren gab es keine wirkliche is- ländische Filmszene. Ab und an konnte man sich alte, recht schlichte Dokumentationen über Island ansehen, aber das war es auch schon. Die Situation änderte sich nur unwesentlich, als das isländische Staatsfernsehen 1966 den Sendebetrieb aufnahm. Die erste Übertragung des Hauptprogramms zeig- te Islands Nobelpreisträger Halldór Laxness, wie er auf einem ungemütlichen Stuhl saß und aus einem seiner Bücher vorlas. Für mich viel wichtiger war das literarische Erbe Islands, vor allem die alten Sagas, die im 13. Jahrhun- dert geschrieben wurden und die wir immer noch Aber noch immer gab es in dem Land keine professionelle Filmindustrie. 1978 baten mich die Regierung und die Stadt Reykjavík, das Reykjavík Film Festival ins Leben zu rufen. Das kleine Grüpp- chen isländischer Filmemacher, die es zu diesem Zeitpunkt gab, forderte von dem Kulturminister die Einrichtung eines Subventionssystems für den isländischen Film. Mehr als zwei ausländische Gäs- te einzuladen, erlaubte das Festival-Budget jedoch nicht. Einer war Pantelis Voulgaris aus Griechen- land, der andere Wim Wenders aus Deutschland. Wim schrieb an jeden Politiker des Landes einen Brief, der sie ermutigte, eine eigene Filmindustrie zu etablieren. Man darf ihn also durchaus als Paten der isländischen Filmindustrie bezeichnen. Aber, wie Dr. Frankenstein schon herausfand: kreieren ist einfacher als kontrollieren. 1979 tat Frankensteins Monster seine ersten wackeligen Schritte mit drei staatlich bezuschussten Spielfilmproduktionen. Und da wachte ich plötzlich auf und realisierte, dass ich mir meinen Traum, zur Filmhochschule zu gehen, nicht erfüllt hatte. Ich hatte in der Schule ein paar experimentelle Filme gedreht, aber nun gab es plötzlich die Möglichkeit, professionell zu arbeiten – und ich war nicht dabei. Ich beschloss, die Idee mit der Filmhochschule fallen zu lassen, da ich dort nur Geld und Zeit verschwenden würde, und stattdes- sen auf meine eigene Weise meine eigenen Filme zu machen. Ich begann mit einer Pressekonferenz, auf der ich verkündete, die berühmteste isländische Saga, die Sage von Njal, zu verfilmen. Die Presse wunderte sich, wie man ohne finanzielle Hilfe ein derart zeit- und kostenintensives Werk verfilmen könnte. Meine Antwort darauf bestand in einer Ra- dio-Botschaft, die Touristen und andere Passanten um Geduld und Verständnis für die Dreharbeiten an historischen Orten im ganzen Land bat. Dann gab ich bekannt, dass es nur eine Aufführung des Films geben würde, in dem größten Kino in Reykjavík mit 1000 Sitzen und zum dreifachen des normalen Ein- trittspreises. Nach einer Stunde war die Vorführung komplett ausverkauft. Was ich dem Publikum in dieser unvergesslichen Nacht präsentierte, war das ohne Wörterbuch lesen können. Diese wundervolle Literatur ist schön strukturiert, voller schwarzem Humor, mit fesselnden Figuren und anschaulich erzählt. Es scheint mir angebracht, hier noch hin- zuzufügen, dass ohne diese Literatur die Norweger heute Schweden wären und die skandinavischen Länder weder lesen noch schreiben könnten. Die norwegische Nation gegründet zu haben, ist natür- lich eine große Verantwortung, aber diese Bürde haben wir nun mal zu tragen. Aus purem Zufall geriet ich im zarten Alter von zwölf Jahren in die Vorführung eines japanischen Films namens „Die sieben Samurai“. Als ich den Saal wieder verließ, hatte ich begriffen, dass es eine an- dere Art Filme gab, nennen wir sie anspruchsvoll. Wie wenn man nach Jahren des Junkfood-Konsums die Gourmet-Küche entdeckt. Mich überraschte, dass der Kurosawa-Film Stilmittel der isländischen Sagas benutzte und von amerikanischen Western à la John Ford beeinflusst war. Dass Ford ein gro- ßer Fan der Sagas war, erfuhr ich viele Jahre spä- ter von seinem Cutter Robert Parrish, der bei der Verfilmung von John Cassavetes „Saddle the Wind“ Regie führte. Auch die Italowestern bedienen sich ja dieser Stilmittel. Wieder passt der Vergleich mit dem Kochen: Wenn Menschen erleben, wie andere Menschen kochen, wird ihr Horizont erweitert und ihre eigene Küche bereichert. In isländischen Kinos waren anspruchsvolle Fil- me damals eine Seltenheit. Deshalb hielt ich es für nötig – für andere wie für mich selbst –, einen Filmverein zu gründen, der es mir ermöglichte, an- spruchsvolle Filme aus aller Welt vorzuführen. Das war 1973, ich ging noch zur Schule. Ich übernahm ein aufgegebenes altes Kino und kaufte einen Projektor, den ich selbst bediente. Der Filmverein wurde ein Erfolg, wir zeigten mehr als hundert Filme pro Jahr. Wir verdienten genug Geld, um eine Kamera und einen Schneidetisch zu kaufen und damit unsere Ideen filmisch umzusetzen. Buch, abgefilmt Seite für Seite. Den Höhepunkt der Geschichte stellt die Szene dar, in der Njals Bauern- hof niedergebrannt wird, mit ihm und seiner Familie darin. An dieser Stelle sah man auf der Leinwand, wie ich das Buch anzündete, und der Rest des Films zeigte das verbrennende Buch. Mit diesem histori- schen Drama habe ich eine Menge Geld verdient, aber nach der Vorführung musste ich die Stadt für einige Zeit verlassen. […] Ich erinnere mich, wie Werner Herzog nach Island kam, als das Filmemachen noch nicht professionell betrieben wurde. Man fragte ihn, ob seiner Meinung nach in Island wichtige Filme entstehen könnten. Herzog kam gerade aus Lima, wo er „Fitzcarraldo“ gedreht hatte, und antwortete: „Wohl kaum. Ich glaube, die wichtigen Filme entstehen in Lima, denn in den Straßen dort herrscht das Elend.“ Da sagte ich: „Entschuldigen Sie, Herr Herzog, aber bei uns Isländern herrscht das Elend im Kopf. Auszug aus dem Vortrag „Sources of inspiration“ Das Elend im Kopf Über die isländischen Quellen filmischer Inspiration Von Friðrik Þór Friðriksson Fridrik Thor Fridriksson, geboren 1954, drehte im Alter von 14 Jahren seinen ersten 8-mm-Film. 1973 gründete er einen Filmklub, 1978 das Filmfestival Reykjavík. Auch wegen seines Organisations- und Finanzierungstalents gilt er als einer der wichtigsten Personen der isländi- schen Filmszene. Internationale Bekanntheit erlangte er 1991 mit dem Film „Börn nátturunnar“ (Kinder der Na- tur), der auf einem Roman von Fridrikssons Schulfreund, dem Schriftsteller Einar Már Guðmundsson, basiert und für einen Oscar nominiert wurde. Es folgten die Filme „Bíódagar“ (1994), „Á köldum klaka“ (1995), „Djöfla- eyjan“ (1996), „Englar alheimsins“ (2000) und zuletzt „Mamma Gógó“ (2010) und die TV-Serie „Seasons oft he Witch“ (2011). Friðrik Þór Friðriksson, geboren 1954, drehte im Alter von 14 Jahren seinen ersten 8-mm-Film. 1973 gründete er einen Filmklub, 1978 das Filmfestival Reykjavík. Auch wegen seines Organisations- und Finanzierungstalents gilt er als eine der wichtigsten Personen der isländi- schen Filmszene. Internationale Bekanntheit erlangte er 1991 mit dem Film „Börn náttúrunnar“ (Kinder der Na- tur), der auf einem Roman von Friðrikssons Schulfreund, dem Schriftsteller Einar Már Guðmundsson, basiert und für einen Oscar nominiert wurde. Es folgten die Filme „Bíódagar“ (1994), „Á köldum klaka“ (1995), „Djöfla- eyjan“ (1996), „Englar alheimsins“ (2000) und zuletzt „Mamma Gógó“ (2010) und die TV-Serie „Seasons of the Witch“ (2011).